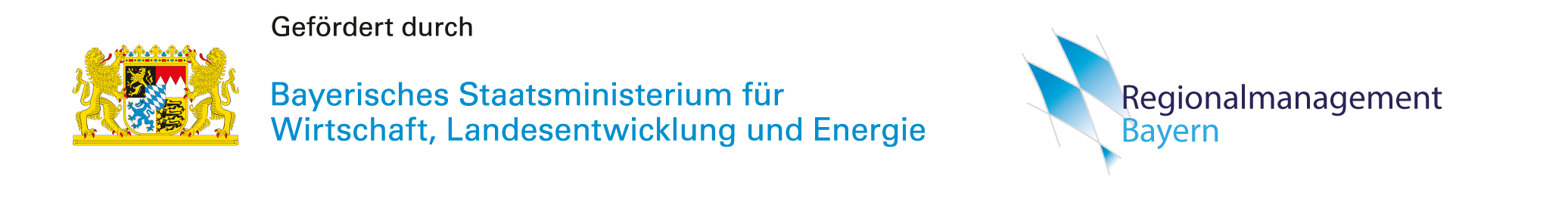Auf der Suche nach Anregungen für Innovationen? – Der Innovationsatlas der Region A³
Alle (233)
Angebote (72)
Angebote A³ (17)
Experten (98)
Praxisbeispiele (46)
Filter zurücksetzen
Expertise Innovation – Prof. Dr. Elisabeth André – Universität Augsburg, Lehrstuhl für Menschzentrierte Künstliche Intelligenz
Die Augsburger Wissenschaftlerin Prof. Dr. Elisabeth André ist eine führende Wissenschaftlerin zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion und Leibniz-Preisträgerin. Als acatech-Akademiemitglied berät sie künftig Politik und Gesellschaft in technikwissenschaftlichen und technologiepolitischen Fragen der Zukunft.
Expertise Innovation – Dr. Stefan Enzler und Rasmus Fackler-Stamm - imu Augsburg GmbH & Co.KG
In ihrem Vortrag auf dem diesjährigen Technologietransfer-Kongress (20. März) zu dem Titel: "Von der Innovationsidee zur echten Veränderung", sprechen Dr. Stefan Enzler und Rasmus Fackler-Stamm darüber, wie ein innovationsfreundliches Umfeld geschaffen werden kann.
Expertise Innovation – Jens-Michael Blümel - adesso SE
In seiner Keynote auf dem diesjährigen Technologietransfer-Kongress geht Jens-Michael Blümel auf ein oft übersehenes, aber umso wichtigeres Thema ein: digitale Barrierefreiheit. Digitale Barrieren begegnen uns nahezu überall: oft sind wir uns den Hindernissen und deren Folgen gar nicht bewusst.
Expertise Innovation – Dr. Marcin Malecha - DLR Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie
In seinem Vortrag auf dem diesjährigen Technologietransfer-Kongress (20. März), erzählt Dr. Marcin Malecha vom Projekt DrapeBot, dabei handelt es sich um eine Mensch-Maschine-Kollaboration für komplexe CFK Fertigung.
Expertise Innovation – Jens-Michael Blümel - adesso SE
Expertise Innovation – Jens-Michael Blümel – adesso SE In seinem Vortrag auf dem diesjährigen Technologietransfer-Kongress (20. März), wird Jens-Michael Blümel über die Materie der digitalen Barrierefreiheit berichten. Mit dem im nächsten Jahr in Kraft tretenden BFSG (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz) wird dieses Thema auf viele Unternehmen Auswirkungen haben. Jens-Michael Blümel gestaltet seit über zwanzig Jahren als „Director User […]
Expertise Forschungspartner vor Ort – Künstliche Intelligenz und Vliesstoffe – Neue Chancen für die Zukunft des Textilrecyclings
Mit einer neuen Kompaktanlage zur Herstellung von Nadelvliesstoffen erweitert das Recycling Atelier der Technischen Hochschule Augsburg (THA) seine Möglichkeiten zur angewandten KI-Forschung.
Expertise Innovation – Prof. Dr. Cordula Kropp - Universität Stuttgart
In ihrer Keynote auf dem diesjährigen Technologietransfer-Kongress wird Prof. Dr. Cordula Kropp über Innovation für die Gesellschaft sprechen und wie wir gemeinsam Fortschritt schaffen: Demokratische Technikentwicklung als Grundlage einer zukunftsfähigen gesellschaftlichen Entwicklung.
Angebot Forschung und Entwicklung – Wasserstoff-Forschung (H2.UniA)
Angebot Forschung und Entwicklung – Wasserstoff-Forschung (H2.UniA) H2.UniA stellt eine interdisziplinäre Kooperation von Lehrstühlen, Arbeitsgruppen und Expertiseträgern an der Universität Augsburg dar, die sich eingehend mit bedeutsamen Bereichen der Wasserstofftechnologien befassen. Damit leistet die Universität Augsburg einen wertvollen Beitrag zu Energiewende und der Umsetzung der Bayerischen-, sowie Nationalen Wasserstoffstrategien. H2.UniA stellt eine interdisziplinäre Kooperation von […]
Innovative Beispiele kommunizieren
Sie haben innovative Projekte umgesetzt oder Expertise in Innovation oder haben Angebote für Unternehmen in diesem Bereich? Reichen Sie einen Artikel ein!
Newsblog – News zum Thema Innovation
News Innovation – sparkscon 2024 – Ein Tag voller digitaler Innovation
Am 20. Juni findet die sparkscon zum dritten Mal in Augsburg statt und bietet allen Digitalisierungsbegeisterten ein einzigartiges Erlebnis. ... mehr
Mehr lesen
News Innovation – Innovatives Kühlsystem für Quantencomputer aus Augsburg
"Solidcryo" hat eine neue Möglichkeit für Tieftemperaturanlagen geschaffen. Nun steht das Forschungsteam kurz vor der Ausgründung. ... mehr
Mehr lesen
News Innovation – Doktorwürde nun auch an der THA – Promotionszentrum DigiTech eröffnet
Das Promotionszentrum DigiTech ermöglicht es nun den Weg von Bachelor über Master bis hin zur Promotion direkt an der THA zu gehen. ... mehr
Mehr lesen
News Innovation – KI-basierte Regelungssysteme
Der Forschungsverbund FORinFPRO erhält knapp 2 Millionen Euro Förderung zur Erforschung KI-basierter Regelungssysteme in der Produktion. ... mehr
Mehr lesen
News Standort – Digitale Agenda für eine bessere "Bürger Experience"
Der Digitalrat der Stadt Augsburg präsentiert die Digitale Agenda „Die Bürger Experience“. In diesem sollen verschiedene strategische Grundlagen und praxisorientierte Empfehlungen ausgegeben werden, um die Digitalisierung am Standort Augsburg weiterzuentwickeln. Letztlich soll so die sogenannte "Bürger Experience" verbessert werden. ... mehr
Mehr lesen
Pressemitteilung 20.03.2024 – Innovation vor Ort - Auf dem Technologietransfer-Kongress 2024
Die unmittelbare Nähe zur Universität Augsburg, zum Technologiezentrum Augsburg und den Forschungsinstituten der Technischen Hochschule, von DLR und Fraunhofer sorgt schon für sich genommen für den direkten Austausch zwischen Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. ... mehr
Mehr lesen
News Innovation – Forschung für alle – Der Podcast der Uni Augsburg
Der neue Wissenschaftspodcast „UniA Research to go“ der Universität Augsburg ist gestartet. ... mehr
Mehr lesen
News Innovation – Durch Studierende zur Problemlösung
Studierende der Universität Augsburg unterstützen Unternehmen bei der Problemlösung. ... mehr
Mehr lesen
News Innovation – Innovative Geschäftsmodelle und Pionierlösungen gesucht!
Am 19.02.2024 ist ein neuer Förderaufruf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gestartet. Den Rahmen bildet das Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP). Ziel des Förderaufrufs sind Innovationen für besseres Lernen und Arbeiten. ... mehr
Mehr lesen
News Standort – #AUXMP24: Wertschätzung für wegweisende Medienarbeit
Das Medienforum Augsburg e.V. lädt zur Nominierung für den Augsburger Medienpreis 2024 ein. Die Preisverleihung findet live am 26. Juli 2024 mit anschließender Gala statt. Die Einreichungsfrist endet am 31.3.2024 ... mehr
Mehr lesen
News Innovation – Auszeichnung der besten Unternehmen Bayerns
Die nächste Erhebungsphase der Wasserstoffbedarfe für die Planung des bundesweiten H2-Netzes läuft vom 07.02. bis zum 22.03.2024. Ob es im Wirtschaftsraum Augsburg-Schwaben 2030 Wasserstoff geben wird, hängt entscheidend davon ab, welche Wasserstoffbedarfe die Unternehmen JETZT melden! ... mehr
Mehr lesen
News Standort – Future Week 2024: Innovation, Digitalisierung und New Work im Fokus
Die Future Week Augsburg rückt näher! Vom 24. bis 28. April 2024 bietet die Veranstaltung, organisiert von der Augsburger Allgemeinen und der Stadt Augsburg, eine Plattform für Innovation, Digitalisierung und New Work. ... mehr
Mehr lesen
News Innovation – Wann kommt Wasserstoff nach Schwaben? Von Ihnen hängt die zukünftige Wasserstoffversorgung der Region ab!
Die nächste Erhebungsphase der Wasserstoffbedarfe für die Planung des bundesweiten H2-Netzes läuft vom 07.02. bis zum 22.03.2024. Ob es im Wirtschaftsraum Augsburg-Schwaben 2030 Wasserstoff geben wird, hängt entscheidend davon ab, welche Wasserstoffbedarfe die Unternehmen JETZT melden! ... mehr
Mehr lesen
News Nachhaltiges Wirtschaften – Ausschreibung des Bundespreis Ecodesign
Seit dem Jahr 2012 wird der Wettbewerb durch das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt in Kooperation mit dem Internationalen Design Zentrum Berlin ausgelobt. ... mehr
Mehr lesen
News Standort – #InnoT24: Auf der Suche nach preiswerten Projekten
Der Innovationspreis Transfer 2024 wird von der Technischen Hochschule Augsburg (THA) mit einem Preisgeld von 5.000 Euro an herausragende Transferkooperationen vergeben. Der A³ Förderverein ist Preisgeldstifter. ... mehr
Mehr lesen
News Innovation – KI-basierte Prozessüberwachung beim Rührreibschweißen
Das KI-Produktionsnetzwerk der Universität Augsburg forscht in Zusammenarbeit mit regionalen Industriepartnern an innovativen Prozessüberwachungstechniken für das Rührreibschweißen (FSW). ... mehr
Mehr lesen
News Innovation – Nächster Entwicklungsschritt der Cloud-Nutzung: EXIST-Förderung für PERIAN
Das Augsburger Start-up PERIAN, gegründet von Christoph Neumaier, Philipp Weiß und Anselm Josek, ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von "Sky Computing" spezialisiert hat. Diese Technologie revolutioniert das Cloud-Computing, indem sie die Grenzen zwischen verschiedenen Cloud-Anbietern überwindet und eine effizientere, nahtlose Nutzung ermöglicht. ... mehr
Mehr lesen
News Innovation – Innovationswettbewerb für Nachhaltigkeit im Bausektor – Ihre Ideen sind gefragt!
Sind Sie ein Unternehmen aus der Baubranche, eine Forschungseinrichtung, oder arbeiten Sie als Planende bzw. Architekten in Bayern? Haben Sie innovative Ansätze für umweltverträglichen, nachhaltigen und ressourceneffizienten Bau? Machen Sie mit beim Ideenwettbewerb! ... mehr
Mehr lesen
News Innovation – Delegationsreise in den Oman und die VAE zum Thema „Exploring waste and hydrogen opportunities“
Unter den Themen Abfallaufbereitung und -sortierung, Wasseraufbereitung und Hygienisierung, Energietechnik, Wasserstoffwirtschaft organisiert die Außenwirtschaftsfördereung der Bayern International und das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung & Energie vom 27.04 ... mehr
Mehr lesen
News Innovation – Wirtschaftsraum Augsburg bündelt Kompetenzen rund um Wasserstoff
Wasserstoff weist ein beträchtliches Potenzial für Unternehmen und Forschungseinrichtungen in der Region auf. Diese und viele weitere Erkenntnis wurden während der 2. Regionalen Zukunftskonferenz Wasserstoff gewonnen, die mit 170 Teilnehmer:innen stattfand. ... mehr
Mehr lesen
Ansprechpartnerin – Haben Sie Fragen?
Social Media Wall – News aus unseren sozialen Medien zu Innovation
Dieses Unternehmen konnte seine CO2-Emissionen bereits um 6,9% verringern! 👏Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft ist ein weltweit führender und innovativer Maschinen- und Anlagenbauer. Innerhalb seiner beiden Geschäftsbereiche Mechanische Verfahrenstechnik und Folienextrusion entwickelt, fertigt und installiert HOSOKAWA ALPINE mit seinen ca. 840 Mitarbeitern am Standort Augsburg Maschinen und Anlagen für Kunden aus der ganzen Welt. 🌍Mit einer konzerneigenen Klimastrategie will das Unternehmen nachhaltig einen Beitrag zur weltweit angestrebten CO2-Neutralität beitragen. Nach der ersten Bilanz und Beratung im Rahmen von A³ klimaneutral konnten die CO2-Emissionen durch Maßnahmen im Bereich Wärmeversorgung um 6,9% reduziert werden. Mit Ökostrom, verstärkt eingesetzten E-Fahrzeugen und Lademöglichkeiten, Absenken von Raum- und Hallentemperaturen sowie aktiver Einbindung der Mitarbeitenden ist die HAAG weiter konsequent auf ihrem Weg zu Klimaneutralität bis 2030. Für Wärmeversorgung und Mitarbeitermobilität stehen mittel- bis langfristige weitere Maßnahmen auf der Agenda. 💬„Wir als HOSOKAWA ALPINE stufen das Thema Klimaschutz als sehr wichtig ein und möchten durch eine ambitionierte Zielsetzung unseren Beitrag leisten. Uns war es dabei ein Anliegen, auf einen lokalen Partner zu setzen. Wir sehen mit A³ klimaneutral und dem Netzwerkverbund vor allem den Nutzen der Zusammenarbeit, weil es sich um kein individuelles Thema, sondern um eine globale Herausforderung handelt, welche auch nur gemeinsam gemeistert werden kann.“ (Dominik Kohlert)Hier erfahren Sie mehr über die HOSOKAWA Alpine AG und deren CO2-Maßnahmen: https://lnkd.in/dzx5Z_Z2Sie haben auch Interesse Teil der Initiative A³ klimaneutral zu werden? Sprechen Sie uns gerne an:Stefanie Haug | Lydia Keller | Andreas Thiel#Nachhaltigkeit #Klimaneutralität #A3Klimaneutral #regiona3 #Augsburg #Innovation
🚀 Erfahren Sie, wie Sie Ihre Digitalisierungsstrategie mit gezielter KI-Integration entwickeln können! 🤖💼"Erst die Geschäftsprozesse, dann die KI" - unter diesem Leitgedanken laden wir Sie herzlich zur Future Week ein! Unternehmen stehen oft vor der Herausforderung, die richtigen Prozesse für die Digitalisierung auszuwählen, während sie gleichzeitig regulatorische Anforderungen berücksichtigen müssen. Doch wie können Sie diese Hürden überwinden und eine maßgeschneiderte Digitalisierungsstrategie entwickeln?Felix Hofstetter von Sonntag IT Solutions sowie Thomas Hildebrecht und Wolf Kunert von adesso SE werden in unserem Online-Format A³ digital_real praxiserprobte Lösungsansätze präsentieren. Erfahren Sie, wie Sie durch die richtige Priorisierung von Prozessen und die Einbindung von KI die digitale Transformation Ihres Unternehmens erfolgreich gestalten können.📅 23.04.2024 🕒 13:00 – 15:00 Uhr 📍 OnlineNach dem Vortrag gibt es die Möglichkeit zum Austausch, wo Sie Ihre Fragen und Anliegen einbringen können. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre digitale Zukunft zu gestalten! 💻🌟Weitere Infos zur Veranstaltung sowie das Anmeldeformular finden Sie unter:👉 https://lnkd.in/dixarzbX#FutureWeek #Digitalisierung #KI #Geschäftsprozesse #Regulatorik #Innovation #Nachhaltigkeit
In diesem Park werden Innovationen geschaffen. 💡Der Augsburg Innovationspark ist ein aufstrebendes Zentrum für Technologietransfer und Innovation in der Region. Hier treffen sich führende Unternehmen, Startups, Forschungseinrichtungen und Investoren, um gemeinsam an zukunftsweisenden Projekten zu arbeiten und Innovationen voranzutreiben. Mit modernster Infrastruktur und einem lebendigen Netzwerk bieten wir eine dynamische Umgebung für kreative Ideen und bahnbrechende Lösungen. Vergangene Woche waren wir mit unserem Technologietransfer-Kongress mittendrin!#ttk24 #AugsburgInnovationspark #Innovation #Technologietransfer #ZukunftGestalten-Anzeige -
Das höchste CO2-Einsparpotential liegt bei den Arbeitswegen. 🚗Ein weiteres Mitglied in unserer Initiative A³ klimaneutral ist das Landratsamt Augsburg mit seinen rund 550 Mitarbeitern (Stand 2022) in seinem Hauptgebäude am Prinzregentenplatz in Augsburg. „Als Behörde streben wir danach, eine Vorreiterrolle einzunehmen, um aktiv zur Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen. Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, regionale Initiativen zu fördern und in einen engagierten Austausch mit anderen Organisationen aus unserer Umgebung zu treten. Wir wünschen uns, im Rahmen der Initiative, mit anderen ähnlichen Organisationen in Kontakt zu kommen, um Herausforderungen zu diskutieren und von Best Practice Beispielen zu profitieren! Für das Landratsamt Augsburg ist schon die Erweiterung der Photovoltaikanlage in Planung. Für die kommende Wintersaison möchten wir die Mitarbeitenden hinsichtlich richtigen Heizens & Lüften schulen und nutzen die Initiative als zusätzliche Motivation. Eine weitere Maßnahme zielt auf ein verbessertes Angebot an vegetarischen Speisen ab.“, so Anna Schmid vom Landratsamt Augsburg. Mit rund 64 % der Emissionen liegt das höchste CO2-Einsparpotential für das Landratsamt bei den Arbeitswegen der Mitarbeiter. Hierbei könnte die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, die Bildung von Fahrgemeinschaften sowie die Nutzung von emissionsarmen Verkehrsmitteln weiterhin und vermehrt gefördert werden. In diesem Bereich sind bereits viele Maßnahmen erfolgt, die es nun gilt, konsequent weiterzuführen bzw. die Anwendbarkeit weiterer Maßnahmen zu prüfen. Welche weiteren Maßnahmen umgesetzt werden sollen und zur CO₂-Bilanz des Landratsamts Augsburg kommen Sie hier👇🏼https://lnkd.in/dGrYckgh#Innovation #Nachhaltigkeit #Klimaneutralität #A3Klimaneutral #regiona3 #augsburg #landkreisaugsburgSie haben auch Interesse Teil der Initiative A³ klimaneutral zu werden? Sprechen Sie uns gerne an:Stefanie Haug | Lydia Keller | Andreas Thiel
Ein guter Tag voll Innovation! 🚀📍 Wir blicken zurück auf eine erfolgreiche Veranstaltung. Über 250 Teilnehmer begrüßten wir zum 12. Technologietransfer-Kongress im Innovationsbogen, dem nachhaltigen Büroneubau im Augsburg Innovationspark.💬 Mit Keynotes von Prof. Dr. Cordula Kropp und Herrn Jens-Michael Blümel, fünf Wissenschaftspitches, Sessions mit Kurzvorträgen am Nachmittag und sechs Exkursionen wurde für ein abwechslungsreiches und informatives Programm gesorgt. ❓ Was hat Ihnen am besten gefallen? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!Mehr Informationen erhalten Sie hier:https://lnkd.in/dgtK6CJH #regiona3 #innovation #technologietransfer #ttk24Vielen Dank für die Unterstützung:Gastgeber:WALTER Beteiligungen und Immobilien AGExklusivpartner:Charrier, Rapp & Liebau | adesso SEPremium Sponsoren und Mitveranstalter:fly-tech IT Digitalpartner | Possehl Analytics GmbH | ZUKUNFTmobil TEA-Netzwerk Partner und Mitveranstalter:DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT- UND RAUMFAHRT E.V. | FIM Forschungsinstitut für Informationsmanagement | Fraunhofer FIT | Fraunhofer IGCV | Technische Hochschule Augsburg | Universität AugsburgPartner: Augsburg Innovationspark | Bavarian Research Alliance (BayFOR) GmbH | edih dibi | HEITEC AG | IHK Schwaben | LEW TelNet GmbH | Neuland Software GmbH | Nuvotex GmbH | STL Steuerungs-Technik-Leuthe GmbH | swa Netze GmbH| WAGNER LIVINGSponsor:Handwerkskammer für Schwaben - Anzeige -
Welche Neuigkeiten gibt’s aus dem Technologiebereich in der Region A³? 🔎Nach einer ausgiebigen Mittagspause mit viel Zeit zum Networking begann der zweite Teil des Technologietransfer-Kongresses #ttk24 mit den #Wissenschaftspitches unter der Moderation von Nadine Kabbeck . Dabei wurden fünf Projekte gepitcht:💥„Gemeinsam Zukunft gestalten im #TTZ. Nachhaltig - innovativ – resilient“ von Mareile Hertel, |Technische Hochschule Augsburg, Technologiezentrum Digitales Planen und Fertigen im Bauwesen💥„Neue Horizonte für die Fusionsforschung und die #Raumfahrt - Additive Multimaterialverarbeitung macht's möglich“ von Dr.-Ing. Georg Schlick Fraunhofer IGCV 💥„Al-Volution: Den Sprung von #Kl-Experimenten zur skalierenden Anwendung meistern“ von Prof. Dr. Wolfgang Kratsch Fraunhofer FIT und Fakultät für Informatik an der Technische Hochschule Augsburg 💥„Innovative #Impfstoffe schneller entwickeln - angewandte Biophysik im Startup-Projekt LISO“ von Dr. Dr. Nicolas Färber Universität Augsburg, Institut für Theoretische Medizin 💥„Unlock sustainability. Inspire the future. - #Nachhaltigkeitsinnovation dank Ko-Kreation“ von Svenja Jahn Technische Hochschule Augsburg, Education and Learning Lab for Sustainability Innovations (ELLSI) als Teil des KI-ProduktionsnetzwerksWeiter ging es mit unserem Nachmittagsprogramm: 💬In drei Sessions konnten insgesamt acht Kurzvorträge besucht werden. Von selbstadaptiven Prozessketten, der Nutzung von IoT-Daten, der neuen Koordinierungsstelle Wasserstoff über Agilität im Unternehmen bis hin zu den 7 Todsünden im Umgang mit Patenten.Nach einer kleinen Pause und weiterer Zeit zum Networking geht es nun weiter mit den nächsten beiden Sessions: 💬von Mensch-Maschine-Kollaborationen über intelligente Entscheidungsassistenzen bis hin zum Microsoft KI-Copilot.Wir wünschen unseren Gästen noch viele gute Gespräche und Inspiration für weitere Innovationen.💡#regiona3 #innovation #technologietransfer
Bereit für einen Tag voll Innovation im Innovationsbogen? 💡👁️🗨️ Mit fünf spannenden Exkursionen startete der Technologietransfer-Kongress! Besucht wurden: •der Augsburg Innovationspark mit Führung durch das Technologiezentrum Augsburg•die Forschungshallen des Fraunhofer IGCV•die Halle 43 des KI-Produktionsnetzwerks Augsburg: eine Exkursion der Universität Augsburg•der Innovationsbogen als Teil des WALTER Innovation Campus•Das DLR - Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie: Die Schmiede innovativer Luftfahrt-Leichtbaustrategien (DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT- UND RAUMFAHRT E.V. )📍 Ganz bewusst haben wir uns in diesem Jahr unsere Lcation ausgewählt und sind zu Gast im Innovationsbogen, dem nachhaltigen Büroneubau der WALTER Beteiligungen und Immobilien AG, im Augsburg Innovationspark. 💬 Die erste Keynote des Tages wurde uns von Prof. Dr. Cordula Kropp, Leitung Institut für Sozialwissenschaften - Lehrstuhl für Soziologie mit dem Schwerpunkt Risiko- und Technikforschung und Direktorin des Zentrums für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart (ZIRIUS) präsentiert. Sie sprach über "Innovation für die Gesellschaft: Fortschritt schaffen und die Kontrolle behalten! " 💬 Jens-Michael Blümel Director User Experience & Brand Strategy bei adesso SE, sprach in der zweiten Keynote über Digitale Barrierefreiheit. Sein Vortrag mit dem Titel "Ein Gewinn für alle – Digitale Barrierefreiheit wird in Deutschland Pflicht" stieß auf großes Interesse. 👥 Jetzt geht’s weiter mit der Mittagspause und viel Zeit für Networking! #regiona3 #innovation #technologietransfer #ttk24Wir danken unseren Exklusivpartnern und Premium Sponsoren:Exklusivpartner:Charrier, Rapp & Liebau | adesso SEPremium Sponsoren:fly-tech IT Digitalpartner | Possehl Analytics GmbH- Anzeige -
Noch einmal schlafen, und dann......beginnt der 12. Technologietransfer-Kongress! 🚀Organisiert von der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH gemeinsam mit zahlreichen Partnern und Sponsoren wird es viele Praxisbeispiele aus der Region zum Thema Innovation und Technologie geben. Es wird viel Zeit zum Austausch, Netzwerken und Entdecken geben!Alle Infos zum Kongress gibts hier👇https://lnkd.in/dgtK6CJHVielen Dank an unsere unsere Partner und Sponsoren💙🔹TEA-Partner:Fraunhofer IGCV | German Aerospace Center (DLR) | Technische Hochschule Augsburg | FIM Forschungsinstitut für Informationsmanagement | Universität Augsburg🔹Exklusiv-Partner:Charrier, Rapp & Liebau Patentanwälte |WALTER Beteiligungen und Immobilien AG | adesso SE🔹Premium-Partner:Possehl Analytics GmbH | fly-tech IT Digitalpartner 🔹Partner:Augsburg Innovationspark | HEITEC AG | LEW TelNet GmbH | STL Steuerungs-Technik-Leuthe GmbH | IHK Schwaben | Handwerkskammer für Schwaben | TEAM23 | Neuland Software GmbH | Nuvotex GmbH | ZUKUNFTmobil #ttk24 #innovation #augsburg #regiona3- Anzeige -
Was nützen Innovationen, wenn sie nicht geschützt werden? Und wie können sie geschützt werden? Mit dem Schutz von Innovationen beschäftigt sich Charrier, Rapp & Liebau, Patentanwälte und präsentiert Möglichkeiten und Wege auf dem Technologietransfer-Kongress 2024 am 20. März. #ttk24 #Innovation #Charrier- Anzeige -
Innovationen benötigen menschliche Kreativität, aber gleichzeitig auch Objektivität. 💡Prof. Dr. Wolfgang Kratsch ist Forschungsprofessor für Angewandte KI an der Technische Hochschule Augsburg. Zudem ist er Direktor am FIM Forschungsinstitut für Informationsmanagement und in leitender Funktion am Institutsteil Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer FIT tätig. 🔎Als Vertreter der Forschungseinrichtungen ist er auf dem Technologietransfer-Kongress am 20. März vor Ort. In seinem Vortrag zeigt er auf, welche transformative Kraft IoT-Daten für die Analyse betrieblicher Prozesse haben. In einer weiteren Session spricht er über AI-Volution und wie der Sprung von KI-Experimenten zur skalierenden Anwendung funktionieren kann. 🚀Mehr Informationen zum Kongress und die Anmeldung finden Sie hier 👇https://lnkd.in/dgtK6CJH#ttk24 #innovation #FIM #FIT #THA
Der Technologietransfer-Kongress steht kurz bevor! 🚀 Haben Sie sich schon angemeldet? ⏰An diesem Tag dreht sich alles um die Entstehung von Innovationen, aktuelle Forschungsergebnisse und die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen. 🔎Neben exklusiven Exkursionen, spannenden Vorträgen und einem umfangreichen Marktplatz bietet der Kongress Gelegenheit zum Netzwerken und zur Diskussion über vielfältige Themen. Dazu gehören beispielsweise Digitalisierung und KI, Arbeit 4.0, Mensch-Maschine-Kooperation, Robotik, Big Data, Materialforschung, Additive Fertigung, Energie- und Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit und Innovationsmanagement. 🌟Anmeldeschluss ist bereits am Freitag, den 15.03.2024! ⏰Die Anmeldung und den detaillierten Ablaufplan finden sie hier 👉 https://lnkd.in/dgtK6CJHWir freuen uns bereits jetzt über unsere Partner und Sponsoren: 💙🔹TEA-Partner: Fraunhofer IGCV | German Aerospace Center (DLR) | Technische Hochschule Augsburg | FIM Forschungsinstitut für Informationsmanagement | Universität Augsburg 🔹Exklusiv-Partner: Charrier, Rapp & Liebau Patentanwälte | WALTER Beteiligungen und Immobilien AG | adesso SE 🔹Premium-Partner: Possehl Analytics GmbH | fly-tech IT Digitalpartner 🔹Partner: Augsburg Innovationspark | HEITEC AG | LEW TelNet GmbH | STL Steuerungs-Technik-Leuthe GmbH | IHK Schwaben | Handwerkskammer für Schwaben | TEAM23 | Neuland Software GmbH | Nuvotex GmbH | ZUKUNFTmobil #ttk24 #innovation #augsburg- Anzeige -
"Die CO₂-Bilanzierung war in jedem Fall erhellend."So Wolfgang Hehl, ein treibender Kopf hinter den Kulissen der Augsburg Innovationspark GmbH. Er enthüllt weiter: "Selbst ein hochmodernes Gebäude wie das Technologiezentrum Augsburg hat unter Berücksichtigung aller Verbräuche einen bemerkenswerten CO2-Fußabdruck und bietet auch noch Verbesserungsmöglichkeiten, wenn man die entsprechenden Tipps bekommt." 💡 🌿Inmitten des Augsburg Innovationsparks und des Technologiezentrums Augsburg arbeiten 15 Forschungseinrichtungen und 55 Unternehmen an wegweisenden Projekten. Von Luft- und Raumfahrt bis hin zu Digitalisierung und Ressourceneffizienz – hier entstehen die Innovationen von morgen. 🚀Schon jetzt wurden bedeutende Optimierungen durchgeführt, darunter eine 100 kWp PV-Anlage, eine energieoptimierte Kompressoranlage und die Nutzung von Brunnenwasser zur Kühlung. Doch das ist erst der Anfang! Eines von vielen weiteren Zielen ist die Umstellung der Beleuchtung auf LED, ein Schritt, der nicht nur die Umwelt schont, sondern auch eine mögliche Einsparung von mindestens 70.000 kWh pro Jahr bedeutet! 🌟🌍Begleiten Sie uns auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft und erfahren Sie hier mehr über Augsburg Innovationspark GmbH 👇https://lnkd.in/d6_ySm9z#Innovation #Nachhaltigkeit #Klimaneutralität #A3klimaneutral #AugsburgInnovationspark
Das Partner-Netzwerk edih dibi (Digital Innovations for Bavarian Industry) bietet kleinen und mittleren Unternehmen ("KMUs") die Möglichkeit, sich zu vernetzen und passende Partner für die gemeinsame Umsetzung der digitalen Transformation zu finden. 🚀Von der Machbarkeitsprüfung über Finanzierung bis hin zum Aufbau entscheidender Fähigkeiten unterstützt das Netzwerk Unternehmen in jedem Schritt ihres Transformationsprozesses. 🌟Interessierte haben die Gelegenheit, sich beim Technologietransfer-Kongress am 20. März bei unserem Partner "Bayern Innovativ" ausführlicher zu informieren und sich auszutauschen. 🔎Die Anmeldung finden Sie auf unserer Veranstaltungswebsite 👇https://lnkd.in/dgtK6CJH.#ttk24 #innovation #BayernInnovativ #EDIHDIBI
Sebastian Augustin und Daniel Nachtrub haben es sich mit ihrem Unternehmen Nuvotex GmbH GmbH zum Ziel gemacht, das Leben der Menschen durch Technologie einfacher zu machen. 🙌🌟Wie genau sie das verwirklichen, zeigen sie als unser Partner im Rahmen des Technologietransferkongresses 2024. 🚀Wir sind gespannt, welche zahlreichen Innovationen und Technologien aus der Region uns an diesem Tag erwarten! 🔎#ttk24 #Innovation #nuvotex #augsburg - Anzeige -
Techologische Innovationen schreiten heutzutage ständig voran... 🌟Trotzdem setzt die LEW TelNet GmbH neue Maßstäbe mit dem "Green-Date-Center". 🚀Wir freuen uns, dass die Lechwerke AG Partner unseres bevorstehenden Technologietransfer-Kongress am 20. März 2024 ist! 🧡Wir sind gespannt auf weitere Einblicke und Austauschmöglichkeiten zu diesem und vieler weiterer Innovationen und Technologien aus der Region! 🔎#ttk24 #innovation #LEWTelnet- Anzeige -
In nur vier Wochen ist es soweit! 🚀Dann wird Augsburg erneut zum Treffpunkt für wegweisende Diskussionen über die neuesten Trends in Forschung und Entwicklung, Innovationen und Technologien. Der Technologietransfer-Kongress steht vor der Tür, und wir freuen uns, dieses Jahr die Neuland Software GmbH als Partner begrüßen zu dürfen! 💙Der Kongress bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich über die jüngsten Entwicklungen in verschiedenen Bereichen zu informieren, innovative Ansätze zu diskutieren und potenzielle Partnerschaften zu erkunden.Seien Sie dabei! 🙌#ttk24 #Innovation #NeulandSoftware- Anzeige -
Roboter wie die der STL Steuerungs-Technik-Leuthe GmbH sind aus der Zukunft nicht mehr wegzudenken. 🔎Umso spannender wird es sein, diesen und weitere zukunftsträchtige Innovationen aus der Region auf dem Technologietransfer-Kongress am 20.03.2024 hautnah miterleben und kennenlernen zu dürfen! 🌟Sie haben Interesse an diesen innovativen Themen?Dann melden Sie sich noch heute zum Kongress an 👇https://lnkd.in/dgtK6CJH #ttk24 #Innovation #STLLeuthe- Anzeige -